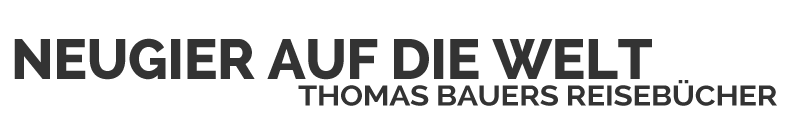Leseprobe: Ostwärts – Zweitausend Kilometer Donau
Mit dem Paddelboot zum Schwarzen Meer
About This Project
Wünschen Sie Ihr Zimmer mit oder ohne Frau?
Ostwärts – Zweitausend Kilometer DonauDas Hotel in Widin kostete fünfundzwanzig Leva, was einem Gegenwert von etwa acht Euro entspricht. Vorausgesetzt man war Bulgare. Ungarn zahlten bereits vierzig, Spanier und Franzosen gar fünfzig Leva. Als ich meinen Reisepass vorlegte, verlangte der junge Mann an der Rezeption stolze sechzig Leva von mir. Immerhin kam ich aus Deutschland, sagte er entschuldigend, der Heimat von Daimler, Bosch und Siemens. Vermutlich dachte er, dass die verlangte Summe, die im Übrigen tatsächlich berechtigt war, nicht mehr als ein Achselzucken bei mir auslösen würde. Ein Glück für mich, dass ich nicht aus den USA kam. In diesem Fall hätte ich nämlich achtzig Leva für eine Übernachtung berappen müssen – vermutlich weil Amerikaner allgemein als gutgläubiger und naiver gelten als Deutsche.
Verglichen mit den Preisen, die man zu Hause für ein Hotel ähnlicher Qualität bezahlt, waren die zwanzig Euro trotz der ungewöhnlichen Preisstaffelung gut investiert. Außerdem sollte ich sofort erfahren, dass das Hotel mit ganz erstaunlichen Extras aufwartete.
»Wünschen Sie Ihr Zimmer mit oder ohne Frau?«, fragte mich der junge Mann an der Rezeption in holprigem Deutsch, aber mit routinierter Selbstverständlichkeit. Zunächst dachte ich, er hätte eine Vokabel falsch gelernt oder würde etwas Entscheidendes verwechseln. Ähnliche Fragen hatte ich auf meiner Reise mehrmals in Bezug auf ein Badezimmer oder einen Balkon gehört, bisher jedoch nie in Bezug auf eine Spielgefährtin. Doch als mein Gegenüber begann, sein Angebot gestenreich auszumalen, bestand kein Zweifel mehr an dessen Inhalt. Die Art, wie ein Mann einem anderen eine Frau beschreibt, dürfte kultur- und gesellschaftsübergreifend nahezu gleich und grundsätzlich eindeutig sein. Es wäre ein ideales Thema für eine vergleichende wissenschaftliche Studie über Ozeane und Generationen hinweg und würde aller Wahrscheinlichkeit nach die Theorien unterstreichen, dass wir (a) alle ursprünglich aus demselben afrikanischen Busch stammen und (b) ziemlich viele Verhaltensweisen von damals in unsere heutige Zeit herübergerettet haben.
Ich nahm ein Zimmer ohne Frau, dafür mit Bad und Balkon.
Dies ist ein Scheit, ein wohlgeschlissenes Schleißenscheit
Die Sonne war in Eile geraten: Sie hastete von Wolke zu Wolke, als sei dies ein kindliches Versteckspiel. Immerhin blieben ihre Strahlen von Mal zu Mal länger am Boden kleben. Langsam aber sicher verdursteten die Pfützen am Ufer.
Dies ist ein Scheit, ein wohlgeschlissenes SchleißenscheitMein zweiter Tag in Serbien hatte begonnen und vor mir lagen Städte, die nach Krieg klangen. Vukovar, Novi Sad, Belgrad.
Ein Bombenkrater hatte die östliche Seite der Eisenbahnbrücke bei Bogojevo in ein scharfkantiges Kunstwerk verwandelt, dessen Stahlausläufer, grotesk verdreht, in alle Richtungen abstanden. Zwei Bauarbeiter hämmerten gerade auf die stählerne Konstruktion ein, als ich unter der Brücke hindurch fuhr. Obwohl sich angesichts dieses Anblicks eine Beklemmung in mir ausbreitete, war mir klar, dass ich in diesem Dorf etwas zu essen auftreiben musste. Auf den vor mir liegenden vierzig Kilometern würde es keine einzige Einkaufsmöglichkeit geben, das hatte Goran mir gestern Abend eingebläut.
Als ich eine Gruppe älterer Männer sah, die auf einer Holzbank am Ufer saßen und sich angeregt unterhielten, band ich Sulina direkt vor ihnen fest. Zunächst ließen sich die angegrauten Herrschaften von meiner Ankunft nicht in ihrem Meinungsaustausch stören, und ich hatte Gelegenheit, einigen Schimpfkanonaden auf Serbisch zuzuhören. Vermutlich drehte sich das Gespräch über die aktuell regierenden Politiker oder über »die da oben in Brüssel« und dürfte sich inhaltlich kaum von deutschen Stammtischdiskussionen unterschieden haben. Stilistisch gesehen kamen mir die Unterschiede hingegen immens vor. Wie in den meisten Balkansprachen wird auch im Serbischen enorm viel gezischt und geröchelt. Die Sprache wimmelt nur so vor »tsch« und »brrz«. Auf der anderen Seite geizt sie ganz enorm mit Vokalen. Als Zeuge des angeregten Gesprächs am Donaurand kam es mir darum vor, als würde der erste der älteren Herren zu seinen Nachbarn etwas sagen wie: »Zwischen zwei schwatzenden Zwetschgensammlern zwitschern zwanzig spitze Spatzenschnäbel.«
»Dies ist ein Scheit, ein Schleißenscheit, ein wohlgeschlissenes Schleißenscheit«, erwiderte der Herr zu seiner Rechten daraufhin, lautmalerisch gesehen, »das schickt Frau Weißen aus Meißen und lässt sagen, dass ihr Mann ein geschickter Scheitschleißenmeister ist.«
Gerne hätte ich diesem interessanten Gespräch noch länger gelauscht, doch da deutete bereits einer der Herren mit dem Finger auf mich, woraufhin der Wortfluss der anderen jäh verstummte. Es folgte ein mir inzwischen vertrautes Ritual, an das ich mich dennoch bis zu meiner Ankunft am Schwarzen Meer gewöhnen musste: Freundlich ging ich auf die Anwesenden zu und fragte, ob sie Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder vielleicht Ungarisch sprächen, wobei ich jedes Mal ein bedauerndes Kopfschütteln kassierte. Auf die Frage, wie wir uns denn unterhalten könnten, tönte mir ein vielstimmiges »Rrrusski« entgegen. Russisch also, was mich leider nicht sonderlich weiter brachte.
Ostwärts – Zweitausend Kilometer Donau Dennoch schafften wir es rasch, eine Kommunikationsbasis herzustellen, die zu etwa zehn Prozent aus deutschen, englischen und spanischen Wortfetzen bestand. Mindestens fünfzig Prozent machten Gestik und Mimik aus, und zwanzig weitere Prozent unsere jeweiligen Blicke. Die restlichen zwanzig Prozent waren pures Erraten auf gut Glück.
Unsere Konversation begann vergleichsweise einfach.
»Zentrum … Centre … where is the middle of this town?«, fragte ich hoffnungsfroh. Woraufhin die Anwesenden ein herzliches Lachen hören ließen und mit den Armen auf zwei baufällige Häuser hinter sich zeigten. »Hier Zentrum, welcome to Bogojevo!«
Anschließend fragte ich nach etwas zu essen und bekam prompt ein Glas mit einer klaren Flüssigkeit darin vor die Nase gehalten.
»Erst drink, dann essen«, versprach mir einer der Anwesenden gönnerhaft.
In manchen Situationen stellt einen das Leben vor harte Prüfungen und es bleibt einem nichts übrig, als die Herausforderungen zu meistern. Dabei fiel mir schmerzhaft ein, dass ich heute noch nichts gegessen hatte. Ich prostete meinen Gastgebern höflich zu, schloss die Augen und kippte den Inhalt des Glases hinunter. Der Effekt folgte auf dem Fuße: So müssen sich die Artisten fühlen, die brennende Fackeln im Mund auslöschen! In den ersten Sekunden spürte ich nur ein Brennen, dann drehte sich mein Magen spontan um neunzig Grad. Meine Leber schrie auf, mein Hals zog sich zusammen und in meinem Mund entstand ein pelziges Gefühl, vermischt mit einem extrem bitteren Geschmack, der zu allem Überfluss mit einem starken Brechreiz einherging. Mein Gönner strahlte mir ins Gesicht, deutete dann auf das Wunderwerk und flüsterte verschwörerisch: »selbst gemacht«.
Ich lächelte verkrampft zurück und versuchte dabei, an möglichst schöne Dinge zu denken – Sonnenaufgänge, Palmenstrände, die ganze Kitschpostkartenpalette. Gleichzeitig fragte ich mich, ob das Gebräu wohl noch aus anderen Zutaten als aus reinem Alkohol bestanden hatte.
Ostwärts – Zweitausend Kilometer Donau Während ich ein weiteres Mal erzählte, wie ich hierhergekommen war, hatte ich Gelegenheit, die Dreiergruppe genauer zu beäugen. Der erste meiner Gastgeber trug einen wilden angegrauten Vollbart, in dem noch die Reste einer vermutlich soeben verzehrten Suppe hingen. Von seinem Gebiss waren ihm nur noch zwei chaotisch wuchernde Schneidezähne geblieben, deren Farbe langsam von einem satten Gelb in ein pastellartiges Ocker überging. Der zweite verfügte über zwei riesige Pranken, die zu den Fingerenden hin sogar noch dicker wurden, als staue sich dort das Blut. Der dritte war vor allem laut und sprach die ganze Zeit in einer Sprache auf mich ein, die er für Deutsch hielt.
Natürlich musste ich, bevor es ans Essen ging, noch zwei der selbst gebrauten Monsterdrinks hinunterstürzen. Keine meiner Ausreden – Sport, leerer Magen, Allergie gegen Ethanol – wurde akzeptiert. Dann endlich folgte ich der Gruppe zu einem der beiden Häuser, die vorher als »Zentrum« bezeichnet worden waren. »Bogojevo downtown« also.
Ich bewunderte das »Weekend Haus« gebührend, dann durfte ich eintreten und bekam neben einem Laib Brot eine Schweinespeckschwarte auf den Tisch gestellt, die praktisch nur aus Fett bestand. Dazu gab es drei Paprikaschoten und eine unermessliche Menge Rotwein. Gesundheitsfanatiker waren meine Gastgeber augenscheinlich nicht. Ihr Körper schien definitiv nicht ihr Tempel zu sein.
Dafür unterhielten wir uns prächtig. Nur einmal kochte die Situation kurz hoch, wobei ich nicht mitbekommen hatte, wie es dazu gekommen war. Ich wusste nur, dass der Schneidezahnträger und der Laute plötzlich auf Serbisch auf mich einschrien. Dabei zeigten sie immer wieder auf die zerbombte Eisenbahnbrücke und riefen »NATO, NATO«, während mir der Verbleibende mit dem Zeigefinger seiner Riesenpranke an die Brust tippte und »warum Krieg, warum Krieg?« wiederholte. Ich wusste es doch auch nicht, gerade wollte ich ihnen dieselbe Frage stellen. Zum Glück einigten wir uns sofort nach diesem Zwischenfall auf zwei Dinge: Erstens sind alle Politiker sowieso machtbesessene Schweinehunde und zweitens sollte man in jedem Fall vermeiden, Dinge zu pauschalisieren.
Die drei waren zufrieden und riefen im Einklang »Freund, Freund, Freund!«, dann wechselten wir über zum nächsten »Weekend Haus«, wo mir ein türkischer Mokka kredenzt wurde – selbstverständlich inklusive eines Schnäpschens, und anschließend gingen wir wieder zu Rotwein über.
So hätte es tagelang weitergehen können. Vermutlich ging es bei ihnen auch tagelang so weiter. Als mir der Vollbärtige jedoch erneut den selbst gebrannten Brennspiritus anbieten wollte, während der Prankenträger wieder von den NATO-Bomben anfing, wurde mir die Sache doch ein wenig unheimlich. Unter Beteuerung meines Bedauerns eiste ich mich los, hinterließ noch meine Telefonnummer und machte mich wieder auf die Fahrt, die noch lang sein würde: Siebenundsechzig Kilometer fehlten noch bis zu meinem heutigen Etappenziel, der Stadt Backa Palanka.
Die Erfolgsgeschichte von Red Bull
Am nächsten Morgen holte ich Sulina um Viertel vor sieben aus dem Unterholz, wischte ihr das anhaftende Laub ab und befreite sie von einigen Schnecken, die nachts ihren Rumpf erobert hatten.
Ostwärts – Zweitausend Kilometer Donau Ich umtrug die Schleuse Nussdorf, um in den Wiener Donaukanal zu gelangen. Siebzehn Kilometer lang würde mich die flotte Strömung des Kanals von West nach Ost durch die österreichische Hauptstadt bringen. Zum meinem Glück war ich heute frühzeitig aufgestanden: Ab zehn Uhr würde die Ausflugsschifffahrt auf dem Kanal einsetzen. Die Wellen der Motorschiffe, die von den hohen Betonwänden des Kanals zurückgegeben werden, hätten mir das Leben schwer gemacht.
So aber brauste ich durch Wien, unterquerte zahllose Brücken, winkte frühen Spaziergängern zu und wich immer wieder Indizien urbanen Lebens aus. Im Zickzack umfuhr ich Plastikflaschen,
Schwammreste, Zahnbürsten und Tupperware, bis ich schließlich eine Red-Bull-Dose versenkte.
Der österreichische Exportschlager verdankt seinen Erfolg nicht nur einem medienwirksam ausgeschlachteten Verbotsversuch in den Anfangsjahren, sondern vor allem einem gelungenen Marketingkonzept, das die Übernahme Salzburger Eishockey- und Fußballvereine ebenso umfasst wie das Sponsoring von Extremsportarten, vom Wellenreiten auf Hawaii bis hin zur Formel 1. Auf diese Weise ist es gelungen, im Bereich Energy Drinks in einhundert Ländern einen Marktanteil von siebzig Prozent mit einem Produkt zu erlangen, das nach Gummibärchen schmeckt und fast ausschließlich aus Wasser, Zucker und Koffein besteht. Mittlerweile werden weltweit pro Sekunde etwa sechzig Dosen Red Bull konsumiert.
Direkt nach meiner Kollision mit der Red-Bull-Dose tauchte links von mir eine Schnauze aus dem Wasser und kam direkt auf mich zu. Keine Handbreit vor Sulinas Bug tauchte sie mit einem lauten Platschen ab. Ich sah noch einen längeren Schwanz, dann schlug etwas an die linke Seite meines Paddels. Ein Biber vielleicht, vermutlich aber eine Ratte. Kaum hatte ich die Begegnung hinter mir, sah ich eine tarantelartige Spinne, die den Kanal auf einem Schwammrest von links nach rechts querte. Sie fuchtelte mit den behaarten Füßen, dann glitt sie an Sulinas rechtem Bordrand vorbei.
Unwillkürlich drehte ich mich um, um sicher zu gehen, dass sie nicht an Bord gesprungen war und jetzt langsam von hinten auf mich zukam – Ähnliches hatte ich mal in einem amerikanischen Horrorstreifen gesehen, und die hinterlegte Geigenmusik war entsetzlich gewesen. Vielleicht schaute ich mir einfach zu viele schlechte Filme an.
In seinem Bestseller »Life of Pi« (deutsch: »Schiffbruch mit Tiger«) hat Yann Martel geschrieben, dass man, wenn man eine Großstadt auf den Kopf stellen und kräftig schütteln würde, erstaunt wäre, was alles an Getier herauskäme: Schlangen, Ratten, Hyänen und vieles mehr. Nach meiner Erfahrung im Donaukanal konnte ich mir Ähnliches in Bezug auf Wien gut vorstellen.
Vom Fluss verschluckt
Ostwärts – Zweitausend Kilometer Donau Eine knappe halbe Stunde, nachdem ich Niederalteich verlassen hatte, drehte ich mich zufällig um und bemerkte, dass ein großes Passagierschiff Richtung Vilshofen unterwegs war. Noch sah es in der Ferne aus wie eine Nussschale, doch ich wusste, dass es mich in etwa zehn Minuten überholen würde. Ich lenkte Sulina nach links und fuhr am dortigen Ufer entlang, um dem Schiff die mit grünen und roten Bojen markierte Fahrrinne zu überlassen. Fünf Minuten später konnte ich den Motor hören und blickte mich erneut um.
Das Schiff wirkte jetzt ungleich imposanter als vorhin. Seine Außenwände waren rot und weiß gestrichen. Deutlich konnte ich einige Passagiere auf dem Oberdeck erkennen. Das Ungetüm kam direkt auf mich zu! Der Fahrer dachte offensichtlich gar nicht daran, den Motor zu drosseln, wie es höfliche Kapitäne zu tun pflegten, wenn sie mich erblickten. Vielleicht träumte er gerade von angenehm warmen karibischen Inseln oder stritt sich mit dem Steuermann. In jedem Fall schien er von seiner eigentlichen Aufgabe abgelenkt zu sein, denn sein Schiff fuhr nicht innerhalb der Fahrrinne, sondern deutlich zu nah am linken Ufer, was angesichts seines Tiefgangs nicht nur gefährlich, sondern bereits fahrlässig war. Der Bug des Stahlkolosses riss das Wasser vor ihm auseinander und drückte es in drei Meter hohen Wellen links und rechts von sich Richtung Ufer, wo es periodisch an Land schwappte. Als nur noch vierzig Meter zwischen mir und dem auf Abwegen fahrenden Riesen waren, konnte ich den Kapitän in seinem Fahrerhäuschen erkennen.
Ich fuchtelte mit dem Kajakpaddel in der Luft herum und schlug es auf die Wasseroberfläche, um auf mich aufmerksam zu machen. Gleichzeitig musste ich aufpassen, dass ich in der strudelreichen Strömung nicht die Balance verlor. Mein Bemühen war indessen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Genauso gut hätte eine Ameise versuchen können, einen afrikanischen Elefanten von seinem Weg abzubringen. Noch dreißig Meter lagen zwischen mir und dem zwanzigmal größeren Dampfer, der nach wie vor ungebremst auf mich zukam.
Ostwärts – Zweitausend Kilometer Donau Die Donau um mich herum wurde unruhig. Es war, als spürte das Wasser, dass hier gleich ein tonnenschweres Ungetüm eine Schneise ziehen würde. Noch zwanzig Meter trennten mich von dem Schiff, noch fünfzehn. Ich verlegte mich aufs Rufen und schrie etwas wie »Abdrehen!« und »Achtung, Kajak!«.
Noch zehn Meter blieben zwischen mir und der Bordwand des Schiffes, die sich über mir auftürmte. Ich machte mich bereit für die Havarie. Bilder von Schiffbrüchigen kamen mir in den Sinn und ich hoffte inständig, dass das alles nur ein schlechter Film war und in den kommenden zehn Sekunden ein gut gebauter, braun gebrannter Held, der eine tragische Kindheit hatte, mit wildem Blick und wallender Mähne zum Kapitän stürzen und ihm ins Ruder greifen würde.
»Scheiße, Mann!«, würde er rufen, weil Fernsehhelden andauernd fluchen und erst ganz am Ende des Films Sex haben, »da ist ein verdammter Kajak direkt vor uns!«, und ehe der tumbe Kapitän, ein blasser Fettwanst, der nur durch Beziehungen auf diesen Posten gelangt ist, reagieren könnte, hätte er das Schiff bereits nach Steuerbord gelenkt und alle, in erster Linie mich, aus der Gefahr befreit. Fanfaren würden ertönen und die drallste Blondine im engsten Kleid, die sich an Bord befand, würde ihm einen besonders langen Blick zuwerfen.
Leider befand ich mich jedoch nicht in einem solchen Film. Ich befand mich genau genommen in gar keinem Film, sondern in einem drei Meter langen Kajak, zehn Zentimeter über der Wasseroberfläche und noch acht Meter entfernt von einer Schiffswand, die mit erschreckender Geschwindigkeit auf mich zukam. Ich schrie mittlerweile wie am Spieß und beschimpfte meinen Gegner mit den übelsten Worten, während ich das Paddel über meinem Kopf hin und her schwenkte. Noch sechs Meter blieben mir, noch fünf. Die Sonne verschwand hinter den Schiffswänden, die zehn Meter über mir aufragten.
Ostwärts – Zweitausend Kilometer Donau Endlich, im denkbar letzten Moment, riss der Kapitän ungläubig die Augen auf, drehte das Ruder mit Macht nach rechts und ließ das Schiff nach Steuerbord ausweichen. Drei Meter von mir entfernt schoss das Ungetüm vorbei. Wäre die Reaktion des Kapitäns zwei Sekunden später gekommen, hätte mich der Koloss unter sich begraben.
Das späte Ausweichmanöver hatte den Effekt, den man vom Skifahren kennt, wenn man plötzlich stoppt oder eine besonders enge Kurve fährt: Es trat eine extragroße Welle los. Sie schlüpfte direkt aus der Bordwand; deutlich konnte ich sehen wie sie sich aufbaute. Ich zog die Spritzdecke des Kajaks fest an und presste meine Knie links und rechts an Sulinas Innenwände, um die kommenden Schwankungen ausgleichen zu können. Dann verlagerte ich meinen Schwerpunkt möglichst weit nach unten. Das alles geschah im Bruchteil von Sekunden, während die Welle auf mich zurollte. Sie reichte aus meiner Perspektive bis zum Himmel und verbarg alles, was hinter ihr geschah.
Und dann wurde ich Zeuge, wie uns der Fluss einfach verschluckte. Fünf Sekunden lang wurden Sulina und ich vollständig unter Wasser gedrückt. Bis die Spitze des Kajaks plötzlich nach oben schoss, als schnappte er nach Luft. Wir machten einen Satz, klatschten auf die Wellen und Sulina brach sofort zur Flussmitte hin aus. Jetzt lagen wir parallel zu den Wellen des Schiffes, die sich gierig auf uns stürzten. Sie hoben uns an, ließen uns in Wellentäler krachen und spielten mit uns wie Robben mit einem Ball. Es war nicht daran zu denken, irgendeine Richtung einzuschlagen. Ich versuchte nur noch, nicht augenblicklich zu kentern. Erst fünf Minuten später ließen die Wellen von uns ab. Mein Gegner, der mich soeben um ein Haar überfahren hätte, war bereits hinter der nächsten Biegung verschwunden.
Bayerischer Jodelkanon in den Schleuse Vohburg
Ostwärts – Zweitausend Kilometer Donau Am Horizont erhob sich eine Mauer aus Beton und spannte sich von einem Ufer zum anderen über die Donau. Unablässig nahm das Elektrizitätswerk Vohburg dem Fluss Energie ab. Als ich näher kam, bemerkte ich am rechten Rand dieser Mauer einen schwarzen Punkt, der sich langsam nach links bewegte. Zehn Minuten später erkannte ich, dass es sich dabei um eine Art schwimmende Holzhütte handeln musste. Deutlich konnte ich ein beigefarbenes Dach erkennen. Wenig später hörte ich Stimmen aus dem Inneren, die sich definitiv bayerisch anhörten.
Offensichtlich war gerade eine hitzige Diskussion über die vor kurzem beendete Fußballweltmeisterschaft im Gang, denn ich verstand Worte wie »Der Klinsi«, »Zidane«, »Bierflasche« und »Sieg gekauft«. Da gleichzeitig das Wasser der Donau an die Seiten meines Kajaks schlug, bekam ich allerdings nur Bruchstücke der Unterhaltung mit und konnte nicht ausschließen, dass es sich vielleicht auch um ein Kartenspiel handelte und die Worte »Da nimm sie«, »Sieh an«, »Vier Asse« und »Ich deck auf« hießen.
Jedenfalls trat alsbald ein fülliger, nur mit einer Stoffhose bekleideter, etwa 65-jähriger Mann aus der Hütte, dessen nachlässig gekämmtes Haar bereits einen Stich ins Silberne andeutete.
»Do schau her, moachst aa Wettrenne?«, rief er mit einem unerwartet klaren Bass, woraufhin drei weitere Männer ihre Köpfe aus der Hütte streckten.
Die vier hießen mit Namen »da Rudi«, »da Olli«, »da Schorsch« und »da Michi«.
»Da Rudi« platzte fast vor Stolz, weil er mich entdeckt hatte. Immer wieder schilderte er seinen Kumpanen die Einzelheiten dieses Vorgangs.
»Wohin seid ihr denn unterwegs?«, fragte ich in einer von »da Rudis« Erzählpausen.
Ostwärts – Zweitausend Kilometer Donau »Wohin’s uns treibt«, hielt »da Olli« fest, der von den vieren am wenigsten bayerisch sprach, dafür aber nie mehr als vier Worte auf einmal sagte.
»Moast samma auf’m Weg ins nächste Gasthaus«, ergänzte »da Schorsch«, ein sehniger, knapp zwei Meter großer Hüne, der bestimmt Probleme hatte, sich in der kleinen und engen Hütte zurechtzufinden.
Währenddessen übernahm »da Michi« die Vorstellung des seltsamen Gefährts. »Hoandwerka samma, do hamma a Floß baut on a Hüttn draufg’stellt, mit alle Schikanen: a Hängemoattn, a Kuhgloaggn on am ächta Generator.«
»Klar, damit ihr abends Licht habt«, zeigte ich mich beeindruckt.
Aber »da Michi« winkte ab.
»Naa«, ließ »da Schorsch« vernehmen, was in dieser Gegend einer Verneinung gleichkommt und für mich immer unglaublich schwer von »Ja« zu unterscheiden ist, weswegen ich grundsätzlich hoffe, dass nach diesem Wort noch weitere kommen, »da Generator broauch ma fürs Bier!«
Tatsächlich war mir bereits aufgefallen, dass sich auf der Bierflasche in »da Michis« Hand Tropfen bildeten, die langsam an der Außenseite hinab flossen. Das illustre Quartett reiste folglich ohne festes Ziel stromabwärts, in einer Hütte, in der es kein Licht und keine Schlafmöglichkeiten gab, dafür aber einen riesigen, von einem Generator mit Strom gespeisten Kühlschrank, der bis oben hin mit Bierflaschen gefüllt war. Die vier hatten klare Prioritäten gesetzt.
Wohin ich eigentlich unterwegs sei, wollte »da Rudi« wissen.
»Mein großes Ziel ist das Schwarze Meer; aber ich schau‘ einfach mal, wie weit ich komme«, entgegnete ich vorsichtig.
Ostwärts – Zweitausend Kilometer Donau »Geh komm!«, lautete »da Rudis« Kommentar, was das Paradebeispiel einer unerfüllbaren Aufforderung sein dürfte. Anscheinend auch so ein Charakteristikum dieser Gegend: der Hang zum Paradoxen. Glücklicherweise wurde das Floß mitsamt Hütte in diesem Moment von einem gewaltigen Rums erschüttert, sodass ich mich vor näheren Erklärungen drücken konnte. Wir waren an der Mauer der Staustufe Vohburg angelangt.
»Oana muass d’Schleusn öffna«, rief »da Schorsch«.
Bevor ich fragen konnte, ob so vielleicht der Vohburger Schleusenwart hieß, kletterte »da Michi« bereits an Land und schob einen Hebel nach links. Langsam öffneten sich daraufhin die Pforten der Selbstbedienungsschleuse, und ich fuhr Sulina direkt hinter der schwimmenden Holzhütte zwischen die Betonwände. Langsam wurde das Wasser aus der Schleuse gepresst. Meter um Meter gelangten wir tiefer. Ich hatte das Gefühl, als wüchsen rechts und links mit Algen bewachsene Betonwände in den Himmel. Die Beklemmung, die einen zwangsläufig in einer solchen Umgebung ereilt, bekämpfte »da Rudi« mit einem probaten Gegenmittel: Er stimmte ein altes Volkslied an, das aus der Region stammen musste, denn ich verstand höchstens jedes dritte Wort. Er sang gar nicht schlecht, was meine Theorie bestätigte, dass reichlicher Alkoholkonsum die Stirnbänder dehnt. Auf »da Olli« und »da Schorsch« traf dies leider nicht zu, doch sie substituierten ihr fehlendes Können damit, dass sie besonders laut sangen. Verbunden mit dem Hall innerhalb der Wände, die sich um uns erhoben,ergab dies den Effekt, als ob gerade ein vielstimmiger bayerischer Chor die Staustufe Vohburg passieren würde. Ein Chor, der kollektiv auf Speed oder zumindest auf Ecstasy sein musste, denn zum Schluss stimmte »da Michi« vom oberen Rand der Schleuse mit einem lang gezogenen Jodeln in den ohnehin schiefen Kanon ein. Keine andere Schleuse habe ich so gerne verlassen wie die von Vohburg.
»Leinen los!« Abfahrt mit Tücken
Wer sich auf ein Tänzchen mit ihr einlässt, dem verwirbelt sie die Sinne. Den nimmt sie mit, verschlingt ihn, spuckt ihn wieder aus und hält ihn minutenlang am Ufer fest, bevor sie ihn von Neuem packt.
Ostwärts – Zweitausend Kilometer DonauVon Strömung zu Strömung wurde der Ahornzweig weitergereicht, bis er zwei Meter unter mir am Ufer hängen blieb. Vielleicht war er ein Schwarzwäldler und vielleicht spendete er manchem Liebespaar Schatten, bevor er sich zu weit über den Fluss beugte. Sein Weg würde noch weit sein, fast so weit wie der des Wassers, das zehn Meter ostwärts um eine Kurve bog.
Hinter diese Kurve sollte die Donau mich führen. Sie sollte mir Passau und Wien zeigen, mich unter Budapests Brücken durchlotsen und zu den großen Ebenen des Ostens bringen. In ihrem Gefolge wollte ich Belgrad erkunden und die Karpaten durchschneiden. Und ganz zum Schluss würde ich zu den Sandstränden des Schwarzen Meeres kommen, die sich zwischen den Weiten Russlands und dem türkischen Orient erstrecken. Ich hatte keine Landkarte bei mir. Ich hatte einen Fluss vor mir, der mir den Weg zeigte.
Vorsichtig ließ ich meinen lilafarbenen Kajak die steile Uferböschung hinabrutschen. Ich hatte ihn erst am Tag zuvor erworben und wusste nicht genau, wie man mit so einem Ding umgeht. Umständlich kletterte ich in die schmale Luke und schloss für einen Moment die Augen, konzentrierte mich ganz auf das Rauschen des Flusses, das mich von jetzt an einen Monat lang begleiten würde. Tag und Nacht würde es bei mir sein, als versuche der Strom hartnäckig, mir etwas zu erzählen. Dann stieß ich ein Ende des Holzpaddels in das schlammige Uferwasser und drückte mich in die Strömung. Meine über zweitausend Kilometer lange Donaureise hatte begonnen.
Thomas Bauer: Ostwärts - Zweitausend Kilometer Donau
Erschienen 2009 im Wiesenburg Verlag
Über das Buch
Abenteuer Flusswanderung: In einem Paddelboot folgt Thomas Bauer der Donau von Deutschland bis zum Schwarzen Meer. Zwischen Regensburg und Passau wird er um ein Haar von einem Passagierschiff versenkt. Im serbischen Bogojevo wird ihm Schweinefett und Höllenschnaps zum Mittagessen angeboten. In Bulgarien fragt man, ob er sein Hotelzimmer mit oder ohne Frau möchte. Mit genauem Blick für die Kleinigkeiten am Wegrand und einer Vorliebe für abstruse Begebenheiten erzählt Thomas Bauer die packende Geschichte seiner dreißigtägigen Kajakfahrt, die ihn durch acht Länder Europas führt.
In der beiliegenden DVD "Reisen und Schreiben", die der Autor gemeinsam mit dem Münchner Regisseur Michael Höhne produziert hat, beschreibt Thomas Bauer seine außergewöhnlichen Reisen und geht auf Einzelheiten der Donautour ein. Zudem enthält die DVD eine Bildershow, Lesungsausschnitte und ausführliches Bonusmaterial.
Reaktionen
» die tageszeitung: Gen Osten paddeln
30 Tage auf der Donau hört sich nach Ruhe und Beschaulichkeit an. Aber Thomas Bauer hat daraus eins der ganz großen Abenteuer gemacht.
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.